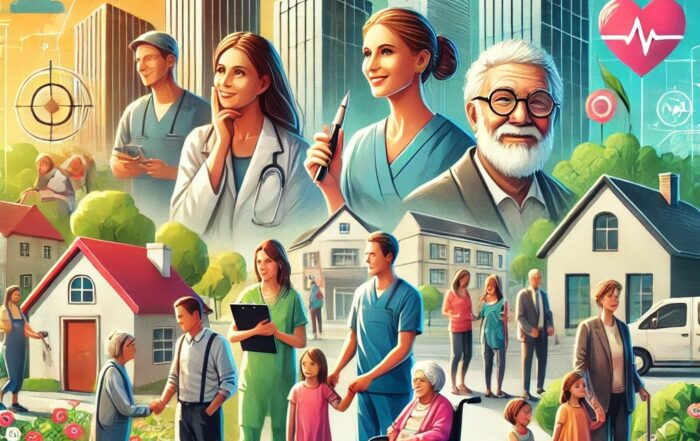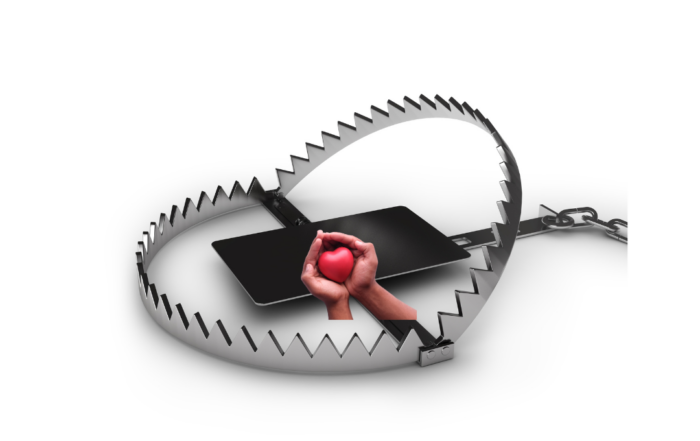Die Soziale Arbeit in Österreich steht vor einer alarmierenden Entwicklung: Zwei Drittel der in der Branche tätigen Menschen denken über einen Berufswechsel nach. Diese Zahlen stammen aus einer Befragung der Arbeiterkammer Wien (AK), die mehr als 4.000 Personen befragt hat. Diese Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, und die dringende Notwendigkeit politischer und struktureller Reformen. (Soziale Arbeit: Zwei Drittel denken über Berufswechsel nach – Inland – derStandard.at › Inland)
Die zentralen Probleme der Sozialen Arbeit in Österreich
Überlastung und Arbeitszeit
Mehr als 60 Prozent der Befragten arbeiten regelmäßig über ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus. Diese Überstunden sind häufig nicht planbar, was die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben massiv erschwert. Gleichzeitig wird die Soziale Arbeit in Österreich stark von Teilzeitanstellungen geprägt: 65 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit, was deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 30 Prozent liegt. Diese hohe Teilzeitquote wird unter anderem durch die hohe Anzahl an weiblichen Fachkräften in der Branche erklärt – mehr als drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen.
Fehlende gesetzliche Regulierung
Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist das Fehlen eines Berufsgesetzes. Im Gegensatz zu anderen Berufen wie der Pflege oder Psychotherapie gibt es keine einheitlichen Standards, die Kompetenzen, Ausbildungsinhalte und Zuständigkeiten der Sozialarbeitenden regeln. Julia Pollak, Geschäftsführerin des Österreichischen Berufsverbands der Sozialarbeiter:innen, betont, dass dies eine Gesetzeslücke darstellt, die dringend geschlossen werden muss. Zwar war ein Berufsgesetz Teil des Regierungsprogramms der aktuellen Koalition, wurde jedoch bisher nicht umgesetzt.
Mängel in der Ausbildung
Auch die Ausbildung weist laut der Arbeiterkammer erhebliche Schwächen auf. Es fehlt an qualitativ hochwertigen Pflichtpraktika, die einerseits den Berufseinstieg erleichtern und andererseits die Praxisnähe der Ausbildung stärken könnten. Hinzu kommt eine unzureichende finanzielle Unterstützung sowohl für Praktikant:innen als auch für Einrichtungen, die diese ausbilden.
Fragmentierte Strukturen
Die Zuständigkeiten in der Sozialen Arbeit sind durch den Föderalismus stark fragmentiert, was die Umsetzung einheitlicher Standards und Regelungen erschwert. Diese Strukturen behindern den Fortschritt und die Entwicklung der Branche erheblich.
Deutschland: Vorreiter, aber noch viel zu tun
Im Vergleich zu Österreich hat Deutschland bereits wichtige Fortschritte erzielt, insbesondere durch die Einführung eines Berufsgesetzes für die Soziale Arbeit. Dieses Gesetz regelt die Ausbildungs- und Qualitätsstandards sowie die Zuständigkeiten der Fachkräfte. Dennoch bleiben auch hier zentrale Herausforderungen bestehen.
Vergütung
Trotz der Fortschritte bleibt die Bezahlung in der Sozialen Arbeit ein großes Problem. Sozialarbeitende in Deutschland verdienen oft weniger als Fachkräfte in vergleichbaren Berufen, obwohl ihre Tätigkeit hohe Verantwortung und emotionale Belastung mit sich bringt. Die niedrige Vergütung macht die Branche für Berufseinsteiger:innen wenig attraktiv und trägt zur Abwanderung erfahrener Kräfte bei.
Fachkräftemangel
Deutschland sieht sich – wie Österreich – mit einem erheblichen Fachkräftemangel konfrontiert. Schätzungen zufolge könnten bis 2030 zehntausende Fachkräfte in der Sozialen Arbeit fehlen. Dieser Mangel führt zu einer Überlastung der vorhandenen Mitarbeitenden und gefährdet die Qualität der sozialen Dienstleistungen.
Weiterentwicklung und Karriereperspektiven
Obwohl das Berufsgesetz eine Grundlage für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit geschaffen hat, fehlen oft klare Karrierewege und ausreichend finanzierte Weiterbildungsangebote. Dies erschwert es Fachkräften, langfristig in der Branche zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.
Potenziale und notwendige Maßnahmen für die Zukunft
Attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland ein zentraler Hebel, um die Soziale Arbeit langfristig zu stabilisieren. Dazu gehören:
- Angemessene Vergütung: Eine Bezahlung, die den Anforderungen und der Verantwortung des Berufs entspricht.
- Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle: Mehr Flexibilität, um Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren.
- Wertschätzung und Anerkennung: Klare gesetzliche Rahmenbedingungen und Maßnahmen zur Steigerung des gesellschaftlichen Ansehens der Sozialen Arbeit.
Ausbildung reformieren und Nachwuchs fördern
Die Qualität der Ausbildung entscheidet maßgeblich über die Zukunft der Sozialen Arbeit. Notwendig sind:
- Vergütete Pflichtpraktika: Um Studierenden den Berufseinstieg zu erleichtern.
- Stärkere Praxisnähe: Durch Kooperationen zwischen Hochschulen und sozialen Einrichtungen.
- Attraktivitätssteigerung für Männer: Der Beruf sollte stärker für männliche Nachwuchskräfte geöffnet werden, um die Geschlechterbalance zu verbessern.
Gesetzliche Regelungen ausweiten
Während Deutschland mit dem Berufsgesetz bereits Fortschritte gemacht hat, muss Österreich dringend nachziehen. Einheitliche Regelungen würden die Professionalisierung der Sozialen Arbeit fördern und die Qualität der Dienstleistungen sichern.
Langfristige Finanzierung und Planung
Soziale Arbeit braucht verlässliche Strukturen. Eine Finanzierung, die über kurzfristige Projektmittel hinausgeht, ist entscheidend, um Kontinuität und Vertrauen zu schaffen. Nur so können Einrichtungen langfristig planen und Fachkräfte binden.
Die Herausforderungen in der Sozialen Arbeit sind in Österreich wie auch in Deutschland erheblich. Während Österreich mit einem fehlenden Berufsgesetz und fragmentierten Strukturen kämpft, hat Deutschland bereits wichtige Grundlagen geschaffen. Dennoch bleiben die Probleme von Vergütung, Fachkräftemangel und fehlenden Karriereperspektiven auch hier drängend.
Die Zukunft der Sozialen Arbeit hängt davon ab, ob es gelingt, die Arbeitsbedingungen grundlegend zu verbessern, die Ausbildung zu reformieren und die gesellschaftliche Wertschätzung zu steigern. Die soziale Infrastruktur ist das Rückgrat einer funktionierenden Gesellschaft – und die Soziale Arbeit verdient es, als tragende Säule entsprechend gefördert zu werden.
Textquelle: Voigt 2025
Bildquelle: DALLE 2025